Dimensionierung Raumlufttechnischer Anlagen
Facility Management: Raumlufttechnische Anlagen » Anforderungen » Dimensionierung
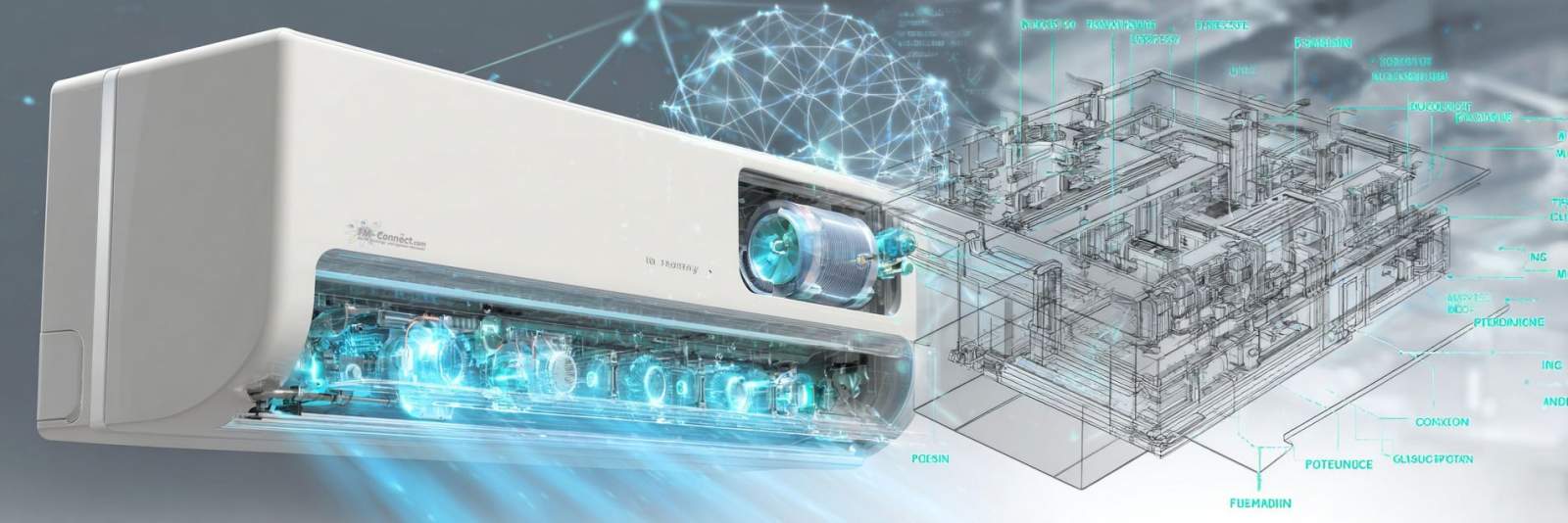
Dimensionskriterien für die Auslegung und Beschaffung betrieblicher RLT-Anlagen
Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) sind heute ein zentraler Bestandteil moderner Betreiberimmobilien, um ein gesundes und komfortables Innenraumklima zu gewährleisten. In Zeiten steigender Anforderungen an Energieeffizienz, Innenraumluftqualität und Betriebskostenoptimierung kommt der richtigen Dimensionierung und Auslegung solcher Anlagen besondere Bedeutung zu. Eine fehlgeplante Anlage – sei es durch Unterdimensionierung oder Überdimensionierung – führt entweder zu unzureichender Luftqualität oder zu vermeidbarem
Energieverbrauch. Die Auslegung und Beschaffung raumlufttechnischer Anlagen in Betreiberimmobilien ist ein vielschichtiges Unterfangen, das technische, wirtschaftliche und nutzerspezifische Aspekte miteinander vereinen muss. Eine sorgfältige Planung im Einklang mit den geltenden Normen – von DIN EN 16798 über diverse VDI-Richtlinien bis hin zu Spezialvorschriften – legt den Grundstein für eine Anlage, die gleichermaßen leistungsfähig wie effizient und betriebssicher ist. Dimensionierungsparameter wie Luftvolumenstrom, Luftwechselrate, Wärmerückgewinnung oder Filterklasse dürfen nie isoliert betrachtet werden. Sie hängen ab von der Gebäudenutzung (z.B. benötigt ein Krankenhaus andere Luftmengen und Reinheitsgrade als ein Büro), von den Gebäudeparametern (z.B. beeinflusst die Dämmung den Heizbedarf der Zuluft) und von Nutzeranforderungen (z.B. Wunsch nach individueller Steuerbarkeit oder besonderer Behaglichkeit). All diese Faktoren müssen in einer ganzheitlichen Planung ausbalanciert werden.
Eine moderne RLT-Anlage soll komfortable Innenraumluft liefern, dabei so wenig Energie wie möglich verbrauchen und einfach zu betreiben sein. Sie ist ein zentraler Baustein für die Nachhaltigkeit von Gebäuden und trägt zur Gesundheit und Zufriedenheit der Nutzer bei. Bei richtiger Dimensionierung und Beschaffung kann eine solche Anlage sogar den Wert einer Immobilie steigern und ihre Betriebskosten senken.
Raumluftqualität und Behaglichkeit
Die primäre Aufgabe von RLT-Anlagen besteht darin, ein gesundes Raumklima sicherzustellen. Dies umfasst das Sicherstellen der Luftqualität, die Kontrolle von Temperatur und Feuchte sowie gegebenenfalls die Filterung von Schadstoffen. Gute Innenraumluftqualität fördert die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Nutzer. Umgekehrt können unzureichende Lüftung und schlechte Luftqualität zu Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Gesundheitsrisiken führen.
Ein wichtiges Kriterium der Luftqualität ist die CO₂-Konzentration, die als Indikator für Frischluftzufuhr dient. Bei normaler Bürotätigkeit wird ein Außenluftvolumenstrom von ca. 25 m³/h pro Person als erforderlich angesehen, um die CO₂-Konzentration unter etwa 1000 ppm zu halten. Neben CO₂ müssen auch flüchtige organische Verbindungen (VOC), Feinstaub und Luftfeuchte in einem akzeptablen Bereich gehalten werden.
Thermische Behaglichkeit ist ein weiterer Grundpfeiler: RLT-Anlagen tragen durch Beheizen oder Kühlen der Zuluft zur Einhaltung angenehmer Temperaturen bei. In Büro- und Verwaltungsbauten liegt die Ziel-Temperatur meist zwischen ~21 °C im Winter und maximal ~26 °C im Sommer; in Krankenhäusern gelten spezifische Vorgaben, z.B. 22–26 °C in leicht bekleideten Behandlungsbereichen. Auch die relative Luftfeuchtigkeit soll meist zwischen 30 % und 60 % gehalten werden, um sowohl Komfort als auch den Bautenschutz (Vermeidung von zu trockener Luft oder Schimmelbildung bei zu feuchter Luft) zu gewährleisten.
Ein zentrales Maß zur Charakterisierung des Lüftungsniveaus ist der Luftwechsel (Anzahl der Luftaustausche pro Stunde). Wohn- und Bürobereiche erfordern typischerweise Luftwechselraten um 2–4 fach pro Stunde, je nach Belegungsdichte und Raumgröße. Höhere Raten sind in Sonderbereichen notwendig – z.B. Laborräume oder medizinische Einrichtungen –, worauf in späteren Kapiteln eingegangen wird. Grundsätzlich müssen RLT-Anlagen die raumlufttechnischen Mindestanforderungen erfüllen, die sich aus Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie baulichen Vorgaben ergeben (z.B. Feuchteschutz in Gebäuden durch Mindestlüftung gemäß Gebäudeenergiegesetz und DIN 1946-6 für Wohnbereiche).
Wichtige Normen und Richtlinien
Die Planung und Auslegung von RLT-Anlagen wird wesentlich durch Normen und Richtlinien geprägt, die den Stand der Technik und Mindeststandards festlegen.
Im Folgenden wird ein Überblick über die wichtigsten Regelwerke gegeben:
DIN EN 16798 (2017ff.): Diese Normenreihe (Nachfolger der früheren DIN EN 13779 und DIN EN 15251) behandelt die Energieeffizienz von Gebäuden mit Fokus auf Lüftung und Raumklima in Nichtwohngebäuden. Insbesondere DIN EN 16798-3:2017 enthält Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen in Nichtwohngebäuden. Hauptziele sind die Förderung der Energieeffizienz und Reduzierung des Energieverbrauchs durch optimierte Lüftungskonzepte. Die Norm betont, dass Lüftungssysteme exakt auf Gebäudegröße und -nutzung abzustimmen sind, um Über- oder Unterdimensionierung zu vermeiden. Zudem werden Wartung und Überprüfung der Anlagen hervorgehoben, um dauerhaft hohe Leistungsstände sicherzustellen. DIN EN 16798-3 definiert außerdem Klassifizierungen der Außenluftqualität (ODA 1–3) sowie Zuluftqualität (SUP 1–5), die als Planungsgrundlage für Filterauswahl und Luftmengen dienen. So entspricht z.B. ODA 1 einer sehr sauberen Außenluft, während ODA 3 stark verschmutzte Außenluft kennzeichnet; abhängig davon müssen geeignete Filterstufen vorgesehen werden, gemäß DIN EN 16890 (Filterklassen nach Partikelgrößen).
VDI 6022 „Raumlufttechnik, Raumluftqualität“: Diese Richtlinienreihe des Vereins Deutscher Ingenieure definiert die hygienischen Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung von RLT-Anlagen. VDI 6022 Blatt 1 (Ausgabe 2018) legt die Hygieneanforderungen fest, um eine gesundheitlich unbedenkliche Innenraumluft zu gewährleisten. Dazu zählen Vorgaben für die Materialauswahl (keine mikrobiell anfälligen Materialien), konstruktive Maßnahmen (z.B. glatte und reinigbare Oberflächen, Kondensatabläufe), Filterkonzepte (mindestens zweistufige Filterung bei Zuluft) sowie regelmäßige Hygieneinspektionen der Anlagen. Betreiber müssen beispielsweise alle 2–3 Jahre eine Hygieneinspektion gemäß VDI 6022 durchführen lassen (bzw. nach DIN EN 15780 für Lüftungshygiene), um sicherzustellen, dass sich keine bioziden Kontaminationen in Befeuchtern, Filtern oder Wärmetauschern ansiedeln. VDI 6022 gilt als anerkannte Regel der Technik und wird meist vertraglich als verbindlich vereinbart. Ihre Einhaltung schützt die Gesundheit der Nutzer und beugt Sick-Building-Syndromen vor.
VDI 3803 „Zentrale RLT-Anlagen – Bauliche und technische Anforderungen“: Diese Richtlinie, zuletzt umfassend überarbeitet 2020, formuliert grundsätzliche Anforderungen an zentrale Lüftungs- und Klimaanlagen für Aufenthaltsräume. Ziel ist ein energieeffizientes, hygienisch einwandfreies und bedarfsgerechtes Errichten und Betreiben von RLT-Anlagen. VDI 3803 (die sogenannten „VDI-Lüftungsregeln“) fordert eine frühzeitige und detaillierte Abstimmung zwischen Bauherr, Nutzern, Architekten und Fachplanern, um die Lüftungsanforderungen präzise festzulegen. Im Anhang der Richtlinie findet sich z.B. eine Checkliste der Nutzeranforderungen, die bei Projektbeginn abzufragen sind – etwa gewünschte Raumtemperaturen, maximale Geräuschpegel, besondere Nutzungszeiten, Zonen mit unterschiedlichen Anforderungen etc. Diese Nutzerbedarfsanalyse bildet die Grundlage für die Dimensionierung. Darüber hinaus enthält VDI 3803 Anforderungen an Komponenten (Ventilatoren, Wärmerückgewinnung, Filter, Brandschutzklappen usw.), an die Regelung und an die Dokumentation der Anlage.
VDI 2081 „Geräuscherzeugung und Lärmminderung in RLT-Anlagen“: In vielen Gebäuden ist der Schallschutz ein kritischer Faktor bei Lüftungsanlagen. Die Richtlinie VDI 2081 behandelt die akustische Planung und Gestaltung von RLT-Anlagen. Sie analysiert Lärmentstehung durch Ventilatoren, Luftströmung in Kanälen, durch Luftauslässe etc., und gibt Hinweise zur Dimensionierung von Schalldämpfern, zur Platzierung von Komponenten und zur Vermeidung von Körperschallübertragung. Planer müssen sicherstellen, dass die an den Aufenthaltsorten ankommenden Schalldruckpegel bestimmte Grenzwerte (typisch 35–45 dB(A) in Büros, ≤30 dB(A) in Wohn- und Ruheräumen) nicht überschreiten. VDI 2081 liefert Berechnungsverfahren und Erfahrungswerte, um bereits in der Auslegung die Geräuschemissionen zu minimieren. Beispielsweise muss bei hoher Luftwechselrate in Konferenzräumen ein entsprechender Schalldämpfer vorgesehen werden, oder es sollten größere Luftdurchlässe mit geringerer Luftgeschwindigkeit gewählt werden, um Strömungsgeräusche zu reduzieren.
Weitere normative Grundlagen: Zusätzlich zu den oben genannten sollten Spezialnormen je nach Gebäudetyp berücksichtigt werden. Für Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen ist DIN 1946-4 maßgeblich, die detaillierte Anforderungen an RLT-Anlagen in Gesundheitsbauten stellt (z.B. Reinheitsklassen der Luft, Filterstufen bis HEPA H13/H14 in OPs, Druckhierarchien zwischen Rein- und Schmutzbereichen). Für Labore existieren branchenspezifische Vorschriften, etwa VDI 2051 für Laborabzüge und Abluftsysteme in Laboratorien, sowie die Unfallverhütungsvorschriften (DGUV-Regeln) für biologische oder chemische Labore, die u.a. Unterdruckhaltung in Sicherheitslaboren fordern. In Gastronomiebereichen (Großküchen) regelt VDI 2052 die Abluftvolumenströme und Auslegung von Küchenabluftanlagen (z.B. sehr hohe Luftwechsel zur Abfuhr von Wärme und Feuchte, typische Werte 15–30 fach/h Abluft). Für Versammlungsstätten (Theater, Kinos) liefert VDI 2082 Orientierungswerte für Luftmengen pro Besucher. Auch die Arbeitsstättenrichtlinien (insb. ASR A3.6 „Lüftung“) sind relevant: sie fordern z.B., dass in Arbeitsräumen die CO₂-Konzentration unter 1000 ppm bleibt, was in der Regel mindestens ca. 30 m³/h Frischluft pro Person erfordert.
Es stellen Normen und Richtlinien sicher, dass RLT-Anlagen Stand der Technik geplant werden. Sie definieren Mindestleistungen (z.B. Mindestaußenluftvolumenströme in verschiedenen Nutzungen, siehe Tabelle in Kapitel Gebäudetypen) und bieten Planern Orientierung bei der Dimensionierung und Qualitätssicherung. Im nächsten Kapitel werden die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Gebäudetypen genauer betrachtet, bevor anschließend die allgemeinen Dimensionierungsparameter systematisch dargestellt werden.
Nutzungsspezifische Anforderungen unterschiedlicher Gebäudetypen
Die erforderlichen Auslegungsparameter einer RLT-Anlage hängen in hohem Maße von der Gebäudenutzung ab. Jede Nutzungsart stellt bestimmte Anforderungen an Luftqualität, Temperatur, Luftmenge und technische Ausstattung. Im Folgenden werden wichtige Gebäudetypen – Büro, Labor, Krankenhaus, Industrie, Logistik sowie weitere Betreiberimmobilien – hinsichtlich ihrer raumlufttechnischen Anforderungen analysiert.
Büro- und Verwaltungsgebäude
Bürogebäude weisen in der Regel eine moderate Belegungsdichte (typisch 5–10 m²/Person in Großraumbüros) und überwiegend sitzende Tätigkeit der Nutzer auf. Die RLT-Anlage dient hier primär der Sicherstellung von Behaglichkeit und produktiver Arbeitsumgebung.
Zentrale Anforderungen sind:
Luftqualität: Für Büroräume wird ein Außenluftvolumenstrom von etwa 20–40 m³/h pro Person empfohlen, je nach gewünschter Qualität. Hochwertige Raumluftqualität (Kategorie I nach DIN EN 16798-1) erfordert tendenziell höhere Werte in diesem Bereich, während der Mindestwert aus Arbeitsschutzgründen bei rund 20–25 m³/h/Pers nicht unterschritten werden sollte. Oft wird auch mit einer Luftwechselrate von ca. 2–3 /h kalkuliert (bei üblicher Raumhöhe um 3 m entspricht das ca. 20–30 m³/h pro m² Nutzfläche). Diese Werte können durch freie Lüftung (Fenster) in Teilzeit erreicht werden, jedoch fordern moderne Bürobauten mit dichteren Gebäudehüllen meist mechanische Lüftung, um jederzeit gute Luftqualität sicherzustellen.
Thermische Konditionierung: Büros erfordern meist Heizen im Winter und immer häufiger Kühlen im Sommer (insbesondere in Gebäuden mit hoher interner Last oder großen Fensterflächen). RLT-Anlagen werden daher oft als Klimaanlagen ausgeführt, d.h. mit Heiz- und Kühlregistern zur Temperaturhaltung. Die Zulufttemperatur wird so geregelt, dass in den Räumen z.B. ~22 °C erreicht werden. Luftfeuchtigkeit wird in Büros meistens nicht aktiv befeuchtet (aus Hygiene- und Energiegründen verzichten viele moderne Konzepte auf Befeuchter), kann aber in speziellen Fällen (Museen, Archive oder sehr trockene Klima) ein Thema sein.
Beispielwerte: Nach älteren Normtabellen (DIN EN 13779) wurde für Büroräume mittlerer Anforderung ein Frischluftbedarf von ca. 36 m³/h pro Person angegeben, was einem CO₂-Niveau um 1000 ppm entspricht. Neuere Regelungen (DIN EN 16798-1) ermöglichen eine Berechnung auf Basis von Ziel-CO₂-Konzentration und Belegungszahl; in der Praxis bleibt man bei ähnlichen Größenordnungen. In kleinen Büros reicht oft schon 1–2 facher Luftwechsel, in stark belegten Konferenzräumen können bis zu 5 fach/h nötig sein, um die Last abzuführen.
Besondere Anforderungen: In Bürobereichen ist Zugfreiheit und niedriger Geräuschpegel wichtig. Die Auslässe (z.B. Deckendiffusoren) müssen so dimensioniert und platziert werden, dass keine unangenehmen Luftzüge an den Arbeitsplätzen auftreten (max. 0,2 m/s im Aufenthaltsbereich). Akustisch sollte die Lüftung nicht störend wahrgenommen werden; zulässig sind typischerweise <40 dB(A) in Büroräumen, was sorgfältige Schalldämpfung nach VDI 2081 erfordert. Betriebszeiten von Büro-RLT-Anlagen orientieren sich am Nutzungsprofil – oft werktags ~10–12 Stunden pro Tag, mit möglicher Nachtabsenkung bzw. Abschaltung außerhalb der Bürozeiten, um Energie zu sparen. Dennoch muss eine Grundlüftung für Luftfeuchteschutz im Gebäude sichergestellt sein (insbesondere im Winter, um Feuchte abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen).
Zusammenfassend benötigen Büros ausreichend dimensionierte Frischluftzufuhr für die Personen, thermisch angepasste Zuluft zur Behaglichkeit und leisen, zugfreien Betrieb. Normative Grundlagen hierfür sind DIN EN 16798, Arbeitsstättenregeln und VDI 3803.
Laborgebäude und Forschungseinrichtungen
Laboratorien stellen sehr anspruchsvolle Bedingungen an RLT-Anlagen, da hier neben Komfort auch Arbeitssicherheit und Prozessschutz gewährleistet werden müssen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen der Raumlufttechnik (RLT) eines Labors und der Prozesslufttechnik (PLT) für Laborabzüge, Digestorien etc..
In Laborgebäuden sind häufig beide Systeme parallel im Einsatz:
Hohe Luftwechselraten: Labore erfordern in der Regel deutlich höhere Luftwechselraten als Büros. Orientierungswerte liegen je nach Laborart bei 6–12 Luftwechseln pro Stunde. Laut VDI 2051 werden für Standard-Laborräume etwa 2–5 1/h Mindestluftwechsel genannt, allerdings sind in vielen chemischen oder biologischen Laboren Werte von 8–10 1/h üblich, um eine ausreichende Verdünnung von Gefahrstoffen zu garantieren. Laborlüftung ist i.d.R. Vollluftsystem (100 % Außenluft) ohne Umluftanteil, um Kontaminationen nicht zu verteilen.
Abluft und Gefahrstoffabsaugung: Wichtig ist die Abführung von Schadstoffen. In Chemielaboren werden i.d.R. Digestorien (Abzugshauben) betrieben, die lokal gefährliche Dämpfe absaugen (das wäre Teil der PLT). Die Abluft dieser Digestorien wird direkt ins Freie geführt, oft über Dach mit ausreichendem Fortlufthauben-Abstand, um Wiedereinsaugen zu vermeiden. Die RLT-Anlage muss die entsprechende Zuluft nachliefern (Raumluft im Labor meist in leichtem Unterdruck gegenüber dem Flur, um Austritt von Gefahrstoffen zu verhindern). Pro Digestorium können Abluftvolumenströme von 200–500 m³/h anfallen; bei mehreren Abzügen summiert sich dies. Daher sind Labore häufig sehr luftdurchsatzintensiv, was zu hohen Betriebskosten führt.
Raumluftqualität und Filter: Für Labore gilt oft nicht primär eine CO₂-Vorgabe (die Personenzahl ist gering), sondern die Konzentration von Gefahrstoffen muss unter Arbeitsplatzgrenzwerten bleiben. Dennoch sollten Labormitarbeiter auch von Frischluft profitieren: typische Außenluftzufuhr pro Person kann im Bereich 20–30 m³/h/Pers liegen, was aber meist durch die notwendigen Luftwechsel ohnehin überschritten wird. Filter: Die Zuluft ist in Laboren zumindest auf Niveau F7/F9 (nach alter Klassifikation) bzw. ePM1 50–80 % nach ISO 16890 zu filtern. Laborabluft wird, falls sie toxische Stäube/Aerosole enthalten könnte (etwa in pharmazeutischen Labs), über Schwebstofffilter (HEPA-Filter H14) geführt, um Emissionen in die Umwelt zu verhindern. Bei biologischen Sicherheitsslaboren (BSL-3/4) sind HEPA-Filter verpflichtend, teils in Doppelstufe redundant, gemäß Biostoffverordnung und entsprechenden technischen Regeln.
Thermische Anforderungen: In vielen Laboren fallen interne Wärmelasten durch Geräte an (Brennöfen, Mikroskope, IT-Geräte etc.), so dass Kühlbedarf besteht. Die RLT-Anlage übernimmt neben Lüftung häufig auch die Raumkühlung. Temperatur und Feuchte müssen evtl. sehr konstant gehalten werden, insbesondere in Forschungsbereichen. Oft sind Soll-Temperaturen um 22 °C und relative Feuchte 50 % vorgesehen, sofern die Prozesse es erfordern (z.B. in einem Kalibrierlabor oder IT-Labor). In chemischen Labs ist zu trockene Luft unerwünscht wegen statischer Elektrizität, zu feuchte Luft kann jedoch Korrosion fördern – ein gewisses Gleichgewicht ist nötig.
Betriebszeiten: Labore werden häufig in langen Tageszeiten oder Schichtbetrieb genutzt, teilweise 24/7 (z.B. in Dauerbetriebslaboren, Prüffeldern). Auch außerhalb der Nutzungszeiten kann es nötig sein, die Lüftung laufen zu lassen, etwa um Kühlgeräte abzuführen oder Mindestluftwechsel zur Sicherheit (etwa Abluft aus Chemikalienschränken) aufrechtzuerhalten. Dies führt zu sehr hohen jährlichen Laufzeiten.
Normen und Vorschriften: Neben VDI 2051 für Laborabzüge sind relevante Regelwerke z.B. DIN EN 14175 (Abzüge – Leistungsanforderungen und Prüfverfahren), TRGS 526 (Technische Regeln für Gefahrstoffe in Laboratorien) und ggf. DIN 1946-7 (Reinräume, falls Reinraumlabore). Diese fordern z.B., dass Laborräume mit Gefahrstoffarbeit in Unterdruck zu umliegenden Bereichen stehen müssen (Druckstufenkonzept), was die RLT-Regelung entsprechend auslegen muss. In summe müssen RLT-Systeme für Labore extrem zuverlässig, robust und oft redundant (Backup-Ventilator oder zweites System) sein, da z.B. ein Ausfall in einem Sicherheitslabor oder Reinraum gravierende Folgen haben könnte.
Krankenhäuser und Gesundheitsbauten
Krankenhäuser, Kliniken und andere Gesundheitsbauten (z.B. Labore der Hygiene, Isoliereinheiten) stellen höchste Anforderungen an RLT-Anlagen in Bezug auf Hygiene, Zuverlässigkeit und spezifische Klimawerte. Die Norm DIN 1946-4 regelt detailliert die Auslegung von raumlufttechnischen Anlagen in Gebäuden des Gesundheitswesens.
Wichtige Aspekte sind:
Raumluftkategorien: Räume in Krankenhäusern werden nach hygienischem Risiko kategorisiert (z.B. OP-Säle, Intensivstationen = Kategorie Ia/Ib mit höchsten Anforderungen; Patientenzimmer = Kategorie II; Nebenräume = III). Für jede Kategorie gibt es Vorgaben zu Luftarten (Anteil Außenluft/Umluft), Filterstufen und Druckverhältnissen. Beispielsweise müssen Operationsräume mit 100 % Außenluft betrieben werden; Rückführung (Umluft) ist dort aus Hygienegründen unzulässig. Allgemeine Pflegezimmer können teils mit Umluftanteil betrieben werden, sofern die Luft ausreichend gefiltert ist.
Luftmengen und Wechselraten: In normalen Patientenzimmern fordert DIN 1946-4 mindestens 40 m³/h Außenluft pro Person. Das entspricht bei zwei Patienten etwa einem Luftwechsel von ~5 /h in einem ~50 m³-Zimmer. In Untersuchungs- und Eingriffsräumen ebenfalls 40 m³/h je Person, sofern keine Anästhesie stattfindet. Bei Narkosegas-Anwendung (OP-Saal) steigen die Anforderungen: dort sind 150 m³/h Frischluft je Patient gefordert, um Narkosegasreste ausreichend zu verdünnen bzw. abzuführen. Insgesamt werden in OP-Räumen typischerweise Luftwechselraten von 20/h und mehr realisiert – häufig durch Turbulenzarme Verdrängungsströmung (TAV) mit einem Deckensegel, das steril filtrierte Luft laminar über dem OP-Feld einbringt. Solche Anlagen bewegen große Volumenströme (z.B. 2400 m³/h für einen 40 m² OP), um die Reinheitsklasse (meist ISO-Klasse 7 oder 5, je nach OP-Art) sicherzustellen.
Filter und Hygiene: Krankenhäuser verlangen mehrstufige Filterung. Zuluft wird meist zweistufig gefiltert: zunächst ein Vorfilter (ePM10 oder ePM2,5 gemäß ISO 16890, früher grob G4/F7) und dann ein Feinfilter ePM1 80 % (entspricht etwa F9). In reinraumartigen Bereichen (OP, Reinheitsbereiche) kommt zusätzlich ein HEPA-Filter (H13/H14) in der Zuluft unmittelbar vor dem Raum zum Einsatz, um keimfreie Luft zu garantieren. Abluft aus infektiösen Bereichen (Isolierzimmer, Labor) wird ebenfalls über HEPA gefiltert, bevor sie ins Freie geht. VDI 6022-Hygieneanforderungen sind in Krankenhäusern besonders streng zu beachten, da immungeschwächte Patienten existieren. Regelmäßige Inspektionen und Wartung (Filterwechsel, Reinigung von Befeuchtern etc.) sind Pflicht.
Druckhaltung: Ein wesentliches Konzept ist die Druckkaskade: Reinbereiche (z.B. OP-Saal) werden leicht überdruck gegenüber angrenzenden Fluren gehalten, damit beim Öffnen von Türen keine unreine Luft einströmt, sondern sterile Luft ausströmt. Umgekehrt werden Isolierzimmer (für infektiöse Patienten) in Unterdruck zu Fluren gehalten, damit nichts aus dem Zimmer entweicht. Diese Druckdifferenzen (oft 10–15 Pa) müssen die RLT-Anlagen über entsprechende Volumenstromregelung aktiv aufrechterhalten. Dazu kommen Schleusensysteme und eine Aufteilung in Rein- und Schmutzluftzonen.
Raumklima: Neben Luftreinheit sind Komfortwerte wichtig: In Patientenzimmern sollen Temperaturen um 22 °C (tags) bis 24 °C nicht überschritten werden, minimal ~19 °C. Im OP darf es nicht zu warm werden (Operationsteam trägt Abdeckung), meist werden 20–22 °C eingestellt. Luftfeuchte in OP-Bereichen soll nicht zu niedrig sein (um statische Entladungen zu vermeiden), ~50 % r.F. ist üblich; allerdings nicht über ~60 % wegen Keimwachstum. All dies bedeutet, dass RLT-Anlagen oft mit Befeuchtung (Dampf-Luftbefeuchter) und Kühlung/Heizung ausgerüstet sind, um ganzjährig konstante Bedingungen zu halten.
Betrieb und Redundanz: Krankenhaus-Lüftungsanlagen laufen in sensiblen Bereichen 24/7, da Räume ständig genutzt werden oder eine Grundlüftung zur Keimzahlbegrenzung gefordert ist. Viele Anlagen sind redundant ausgeführt: z.B. doppelte Ventilatoren (N+1 Redundanz), Notstromversorgung für Lüftung, Ersatz-Kälteerzeuger etc., um Ausfälle zu vermeiden. Bei Beschaffung muss daher auf hohe Ausfallsicherheit geachtet werden.
Normative Orientierung: Zusammengefasst wird in Krankenhäusern streng nach DIN 1946-4 geplant. Diese verweist auch auf DIN 13080 (Krankenhausbau) und weitere Richtlinien. Zudem gibt es spezifische Empfehlungen der Krankenhaushygiene-Kommission (KRINKO) für raumlufttechnische Anlagen, die z.B. definieren, welche Räume klimatisiert sein müssen und welche Filterklassen eingesetzt werden sollen, um nosokomiale Infektionen zu minimieren.
Industriehallen und Produktionsstätten
Industrie- und Fertigungsgebäude haben sehr vielfältige Anforderungen, abhängig von der Branche und den Prozessen. Generell unterscheidet man Arbeitsplatzbezogene Lüftung zur Sicherung von Gesundheit/Komfort der Mitarbeitenden und Prozesslüftung zur Führung von Prozessabläufen (z.B. Trocknung, Rauchabzug, Kühlung von Maschinen).
Raumlüftung für Arbeitsplätze: In vielen Produktionshallen ist eine gewisse Lüftung nötig, um Abwärme, Feuchte oder Schadstoffe abzuführen. Beispielsweise in einer metallverarbeitenden Halle mit Schweißarbeitsplätzen muss Rauch abgesaugt werden (Punktabsaugung, PLT) und zusätzlich Frischluft zugeführt werden. Oft werden Hallen mit hohem Volumen (große Raumhöhe) belüftet, indem entweder dezentrale Geräte (z.B. Dachlüfter oder Wandventilatoren) eingesetzt werden oder zentrale RLT-Anlagen mit weit verzweigtem Kanalnetz. Die Luftwechselrate ist stark von der Prozessbelastung abhängig: Werte zwischen 2–6 1/h sind typisch als Grundlüftung (z.B. 4 fach in Werkstätten). Bei starken Emissionen lokal kann die effektive Erneuerung in der Nähe sogar viel höher sein (z.B. Schweißrauchabsaugungen mit 10–20 fachem Austausch lokal). Pro Person werden in Industriebereichen mindestens 30 m³/h Frischluft empfohlen, oft jedoch überlagert durch Prozessanforderungen.
Prozesslufttechnik: In industriellen Anwendungen sind oft spezielle Lüftungssysteme erforderlich, die Teil des Produktionsprozesses sind: etwa Trocknungsprozesse, Lackierkabinen, chemische Reaktoren mit Abzügen, Reinräume in der Halbleiterfertigung etc. Diese PLT-Anlagen unterliegen branchenspezifischen Vorschriften und werden nicht primär durch Komfortnormen gesteuert. Dennoch müssen sie in die Gesamtlüftung integriert werden (z.B. Nachströmöffnungen, Ersatzluft für abgesaugte Luft). Bei Lackierereien z.B. sind riesige Luftmengen nötig (Hallenkonzepte mit bis zu 50 fachem Luftwechsel, große Filterwände und Lösungsmittelabscheidungen). In Reinproduktionsstätten (z.B. Pharma, Elektronik) kommen Reinraumklassifikationen zum Tragen (ISO 14644 Klassen), die sehr hohe Luftwechselzahlen erfordern (100–600 fache, um Partikelkonzentrationen gering zu halten). Diese speziellen Fälle erfordern maßgeschneiderte Planung.
Temperatur und Klima: In vielen Industriehallen steht eher der Wärmeschutz im Vordergrund, da Maschinen und Prozesse viel Wärme abgeben können. RLT-Anlagen müssen ggf. Kühlung bereitstellen oder zumindest für ausreichend Luftaustausch sorgen, damit die Hallentemperaturen nicht unzumutbar steigen (Arbeitsschutz schreibt bei >26 °C am Arbeitsplatz Maßnahmen vor). Im Winter hingegen muss eine Mindesttemperatur (z.B. ≥17 °C bei schwerer körperlicher Arbeit laut Arbeitsstättenrichtlinie ASR A3.5) gehalten werden. Daher haben viele Hallenlüftungsanlagen eine Warmluftheizung integriert (z.B. Gas-Lufterhitzer oder Warmwasser-Heizregister). Eine vollständige Klimatisierung (Kühlung) ist aus Kostengründen selten flächendeckend, außer in Bereichen mit präzisen Anforderungen.
Filterung: Je nach Umgebung müssen Außenluftfilter eingesetzt werden, gerade in Industriegebieten (ODA 2 oder 3 nach DIN EN 16798, siehe oben) sind mindestens zweistufige Filter üblich. Innen kann es auch erforderlich sein, Abluftfilter einzusetzen, bevor Luft nach außen geblasen wird – etwa Staubfilter bei staubigen Prozessen oder Aktivkohlefilter, falls Lösemitteldämpfe absorbiert werden müssen (um Emissionsgrenzwerte einzuhalten, siehe TA Luft).
Besondere Herausforderungen: Explosionsschutz (ATEX) kann ein Thema sein, wenn brennbare Stäube oder Gase vorkommen. Dann müssen Lüftungssysteme ggf. ex-geschützte Ventilatoren und Motoren besitzen und so dimensioniert sein, dass zündfähige Gemische vermieden werden (z.B. permanenter Abluftstrom, um unter 25 % der UEG zu bleiben). Ein anderes Thema ist Zonentrennung: In großen Hallen will man oft Klimazonen schaffen, z.B. beheizte Arbeitszonen vs. unbeheizte Lagerbereiche. Das beeinflusst die Luftführung (z.B. Luftschleieranlagen an Toren).
Regelwerke: Neben allgemeinen Normen greifen hier oft Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) und BG-Vorschriften. Die Berufsgenossenschaften haben z.B. Regeln für Lüftung beim Schweißen (DGUV-Information), für Umgang mit Kühlschmierstoffen etc. VDI-Richtlinien wie VDI 2262 (Luft in der Produktion) oder branchenspezifische sind ebenfalls relevant.
In Summe müssen RLT-Anlagen in der Industrie flexibel anpassbar sein, oft in Modulbauweise (damit Erweiterungen oder Änderungen im Prozess berücksichtigt werden können) und robust für teils raue Betriebsbedingungen. Die Dimensionierungsparameter orientieren sich hier weniger an standardisierten Komfortvorgaben, sondern an individuellen Berechnungen von Wärmelasten, Stofflasten und den erforderlichen Konzentrationsbegrenzungen pro Prozess.
Logistik- und Lagergebäude
Logistikzentren, Lagerhallen und Distributionsgebäude haben wiederum eigenständige Anforderungen. Im Fokus steht hier oft der Schutz der gelagerten Waren sowie die Schaffung eines verträglichen Arbeitsumfelds für das Lagerpersonal, wobei die Personendichte meist gering und die Volumina groß sind.
Mindestlüftung: In Lagerhallen mit niedriger Belegungsdichte wird die notwendige Lüftung oft bereits durch Infiltration (Undichtigkeiten, Toröffnungen) oder einfache mechanische Lüfter erreicht. Gesetzlich gibt es jedoch Anforderungen z.B. aus dem Bauordnungsrecht (Versammlungsstättenverordnung, falls z.B. viele Personen gleichzeitig anwesend sein könnten) und Arbeitsstättenrichtlinien. Als grober Richtwert sollte auch in großen Hallen ein Luftwechsel von ~0,5–1 1/h ermöglicht werden, um Feuchtigkeit abzuführen und abgestandene Luft zu vermeiden. Wenn im Lager mit Flurförderzeugen (Staplern) gearbeitet wird, die Abgase emittieren (Diesel/Gas-Stapler), muss deutlich mehr Luftaustausch sichergestellt sein oder es sind Abgasfilter bzw. Elektro-Stapler zu verwenden.
Temperaturhaltung: Viele Lager sind nur minimal beheizt (z.B. auf >5–10 °C, um Frost zu vermeiden). Mitarbeiter in Lagern kleiden sich entsprechend; es gelten niedrigere Solltemperaturen als im Büro. Die Arbeitsstättenregel ASR A3.5 erlaubt bei körperlich schwererer Tätigkeit in kühler Umgebung z.B. 12 °C als ausreichend, sofern Schutzkleidung getragen wird. Dennoch muss ein Grundkomfort da sein – oft werden Zonen beheizt, etwa Packbereiche oder Büros in der Halle. Kühlhäuser (Spezialfall: gekühlte oder gefrorene Lager) haben gar entgegengesetzte Anforderungen: dort muss Wärme hereingebracht (beim Eintreten) möglichst vermieden werden, Lüftung ist auf das Nötigste beschränkt, um die Kälte nicht zu verlieren.
Feuchteschutz: In ungeheizten Lagern kann Feuchtigkeit problematisch werden – Kondensation an kalten Wänden oder auf gelagerten Waren. Hier ist Lüftung als Entfeuchtung wichtig, insbesondere in Übergangszeiten. Steuerungen können hygrostatgesteuert lüften (d.h. nur bei zu hoher Innenfeuchte gegenüber außen).
Brandschutzlüftung: Logistikbauten unterliegen häufig Anforderungen an Entrauchung. Zwar gehört dies streng genommen zur Brandschutztechnik (RWA – Rauch- und Wärmeabzugsanlagen), aber sie greifen in die Lüftungsplanung ein. Natürliche Rauchableitung über Rauchöffnungen oder maschinelle Entrauchung mit Ventilatoren müssen vorgesehen sein, die im Brandfall große Volumina abführen. Diese Systeme sind oft in Kombination mit Lüftung (Zuluft nachströmen durch Öffnungen) zu betrachten.
Geruchsstoffe: In Lagerhallen können gelegentlich Emissionen aus Lagergut auftreten (z.B. Ausdünstungen von Chemikalienlager, Lebensmittelgeruch in Logistik für Nahrungsmittel). Die RLT-Anlage kann mit Bedarfslüftung ausgestattet sein, z.B. CO₂- oder VOC-Sensorik, um bei erhöhten Konzentrationen die Lüftung zu verstärken.
Lüftungskonzepte: Oft werden Hallen über Dachlüfter entlüftet (thermischer Auftrieb und Ventilatoren) und Zuluft strömt über Tore und Undichtigkeiten nach. Modernere Anlagen nutzen aber auch zentrale RLT-Geräte mit Luftkanälen: z.B. Textilschläuche zur zugfreien Einbringung großer Luftmengen in hohen Hallen. Solche Lösungen kommen zum Einsatz, wenn definierte Konditionen erforderlich sind (z.B. in einem Archivlager, wo Temperatur/Feuchte eng begrenzt sein müssen).
Im Vergleich zu anderen Gebäudetypen liegt der Schwerpunkt bei Logistik-RLT auf robuster Einfachheit und geringen Betriebskosten, da die Margen in der Logistik oft knapp sind. Wärmerückgewinnung z.B. lohnt sich in teilweise unbeheizten Lagerhallen kaum, daher werden RLT-Geräte dort oft ohne WRG beschafft (eine Ausnahme: wenn große Temperaturdifferenzen regelmäßig bestehen, kann WRG trotzdem sinnvoll sein, etwa in Warenausgangsbereichen im Winter, um warme Abluft zu nutzen). Normativ gibt es für einfache Lager keine speziellen Lüftungsnormen; es wird auf allgemeine Regeln zurückgegriffen, wie z.B. DIN EN 16798 (Nichtwohngebäude) und VDI 3803, sowie branchenspezifisch auf Lagerungsvorschriften, falls gefährliche Stoffe gelagert werden (z.B. TRGS 510 für Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten, welche auch Lüftungskonzepte fordert, etwa 5 Luftwechsel für bestimmte Gefahrstofflagerräume).
Weitere Betreiberimmobilien
Unter Betreiberimmobilien fallen alle Gebäude, die von einem Betreiber professionell gemanagt werden, etwa öffentliche Gebäude, Bildungsstätten, Einkaufszentren, Flughäfen, Rechenzentren etc.
Einige Beispiele und ihre RLT-Besonderheiten:
Schul- und Bildungsgebäude: Ähnlich Büros, jedoch oft höhere Belegungsdichte in Klassenzimmern. Pro Schüler rechnet man ~30 m³/h Frischluft, wodurch in Klassenräumen (z.B. 30 Personen, 60 m²) Luftwechsel von ~5–6/h resultieren. Zentrale RLT-Anlagen in Schulen gewinnen an Bedeutung, um CO₂ und Aerosole (Thema Infektionsschutz) zu kontrollieren. Betriebszeiten beschränken sich auf Schulstunden, Absenkbetrieb nachmittags/wochenends.
Einzelhandel, Shopping-Center: Hier sind zeitweise sehr hohe Personendichten, z.B. 0,2–0,3 Personen/m² in vollen Geschäften. Entsprechend hohe Luftmengen müssen bereitgestellt werden (VDI 2082 nennt für Verkaufsräume etwa 4–8 Luftwechsel). Zudem kommen erhebliche interne Lasten durch Beleuchtung und Geräte hinzu, so dass die Lüftungsanlage auch kühlen muss. Große Malls haben oft zentrale Klimaanlagen mit sehr hohen Umluftanteilen (aus Energiespargründen), aber Frischluft wird nach Personenzahl bemessen eingebracht.
Gastgewerbe (Hotels, Gaststätten): Neben Komfort in Gasträumen (Raucher/Nichtraucher-Trennung, Geruch und CO₂-Abfuhr) sind hier Küchenlüftungen (nach VDI 2052) wichtig. Restaurants erfordern ca. 20–30 m³/h Frischluft pro Gast; in Versammlungsstätten mit Tanz sogar mehr. In Hotels sind individuelle Lüftungssysteme pro Zimmer (Fan-Coils oder Lüftungsgeräte) üblich, um Gästen die Kontrolle zu geben, während zentrale Anlagen die Flure und Gemeinschaftsbereiche versorgen.
Rechenzentren: Diese haben primär Kühlbedarf; reine Frischluftzufuhr ist nachrangig (Personal hält sich kaum dort auf). Lüftungsanlagen dienen der Klimatisierung mit hoher Kälteleistung. Ausfallsicherheit ist kritisch: Redundanz N+1 oder 2N ist Standard. Freie Kühlung (Nutzung kühler Außenluft) wird eingesetzt, aber gefiltert (um Staub von Servern fernzuhalten). Luftmengen sind enorm – oft große Umluftkühlgeräte, die ganze Räume umwälzen; Frischluft nur zur Druckhaltung und Minimalanforderung.
Schwimmhallen/Sporthallen: Schwimmhallen (VDI 2089) erfordern RLT zum Feuchteabtransport (Luftwechsel 4–6/h) und Klimatisierung; sie müssen zudem mit Entfeuchtern/WRG ausgestattet sein, um die enorme latente Last zu bewältigen. Sporthallen brauchen viel Zuluft bei Veranstaltungen; Normen fordern bestimmte Volumen pro Sportler/Zuschauer.
Diese Vielfalt an Betreiberimmobilien zeigt, dass die RLT-Anlagen immer maßgeschneidert an die Nutzung angepasst werden müssen. Ein pauschales Schema reicht nicht aus – Planer müssen die spezifischen Lasten und Anforderungen jeder Nutzung erheben und daraufhin die Anlage dimensionieren. Im nächsten Kapitel werden die verschiedenen Dimensionierungsparameter vorgestellt und erläutert, wie sie abhängig von Nutzung, Gebäudeparametern und Nutzeranforderungen zu wählen sind.
Zentrale Dimensionierungsparameter und Auslegungsgrößen
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Dimensionierungsparameter für RLT-Anlagen systematisch dargelegt. Diese Parameter bestimmen die Größe, Leistungsfähigkeit und Ausführungsdetails der Anlage. Zudem wird erläutert, wie sie von Nutzungsart, Gebäude und Anforderungen beeinflusst werden. Zu den behandelten Parametern zählen insbesondere Luftvolumenströme, Luftwechselraten, thermische Parameter (Temperaturdifferenzen, Heiz-/Kühlleistung), Energieeffizienzkennzahlen, Betriebszeiten, Wärmerückgewinnung, Filterklassen sowie weitere Gesichtspunkte wie Schallpegel und Druckhaltung.
Luftvolumenstrom (Außen- und Umluft)
Der Luftvolumenstrom einer RLT-Anlage – meist angegeben in m³/h – ist die zentrale Auslegungsgröße. Er bezeichnet die Menge an Luft, die pro Stunde gefördert und aufbereitet wird. Wesentliche Unterscheidung: Außenluftvolumenstrom (Frischluft von außen) vs. Zuluftvolumenstrom insgesamt (Außenluft + eventuell Umluft gemischt).
Die Auslegung des Volumenstroms erfolgt in der Regel nach zwei Kriterien:
Personenbezogener Bedarf: Für jede Person, die sich im Raum aufhält, wird ein Mindest-Außenluftstrom vorgesehen (z.B. 30 m³/h/Person im Büro, 40 m³/h/Patient im Krankenhaus). Dieser Wert resultiert aus Anforderungen an die Raumluftqualität (CO₂, Gerüche etc.). Summiert über die max. Personenzahl im Versorgungsbereich ergibt sich ein Grund-Frischluftbedarf.
Raumbezogener Bedarf: Unabhängig von Personen können stoffliche oder thermische Lasten einen Luftstrom erfordern. Beispiele: In einer Küche müssen pro m² Wrasenfanghaube bestimmte m³/h abgesaugt werden (VDI 2052: z.B. 90 m³/h pro m² Wrasenfläche). In einer Lagerhalle kann ein minimaler Luftaustausch pro m² gefordert sein (etwa 0,5 m³/h/m²). In Reinräumen wird nach Partikelreinheit dimensioniert: hier ergibt sich der Volumenstrom aus der geforderten Anzahl Luftwechsel, die nötig ist, um Partikel abzutransportieren.
Der größere der beiden Bedarfe (personen- vs. raumbezogen) ist dann maßgebend. In vielen Fällen dominieren die Personenbezogenen Werte bei Büros, Klassenzimmern, etc., während in Industrie/Labor oft die prozessbezogenen Werte größer sind.
Berechnungsbeispiel: Ein Büroraum 100 m² Grundfläche, 3 m hoch (Volumen 300 m³) mit 10 Mitarbeitern. Gefordert sei 30 m³/h/Pers Frischluft. Personenbedarf = 10 * 30 = 300 m³/h. Gleichzeitig als Raumrichtwert: 2 facher Luftwechsel wären 600 m³/h. Hier ist der 2 Luftwechsel (600 m³/h) strenger, man würde also ~600 m³/h Außenluft vorsehen, um sowohl Luftqualität als auch Feuchteschutz sicherzustellen. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass man stets beide Ansätze prüft.
Reserve und Flexibilität: Man dimensioniert Volumenströme gerne mit einer Reserve (z.B. +10–20 %), insbesondere wenn zukünftige Nutzungsänderungen möglich sind. Allerdings bedeutet jede Überdimensionierung auch höheren Energieverbrauch bei Teillast, daher sollte anstelle starrer Reserve eher flexible Regelung eingeplant werden – z.B. Volumenstromregler, die bei Bedarf Hochfahren können, oder modulare Geräteerweiterungen. Moderne Steuerungen erlauben es, den Volumenstrom dem realen Bedarf anzupassen (CO₂-gesteuerte Lüftung in Meetingräumen, Volumenstromabsenkung bei geringer Belegung etc.).
Umluftanteil: In vielen Anlagen wird nicht die volle Luftmenge als Außenluft bereitgestellt, sondern ein Teil wird als Umluft geführt (besonders bei Klimaanlagen zur Energieeinsparung). Der Außenluftvolumenstrom ist dann meist = Mindestfrischluft (z.B. 30 % der Zuluft), während die restlichen 70 % Umluft im Umluftbetrieb gekühlt/gewärmt werden, aber keine neue Frischluft bringen. Normen wie DIN EN 13779 (bzw. 16798) kategorisieren die Luftqualitätsanforderungen und den max. zulässigen Umluftanteil. In hygienisch sensiblen Bereichen (OP, Labore) ist Umluft unzulässig oder sehr gering. In Einkaufszentren oder Theatern wird dagegen oft ein hoher Umluftanteil gefahren (z.B. nur 20 % Außenluft bei Vollklimatisierung), solange CO₂ und Gerüche im Rahmen bleiben.
Der Volumenstrom bestimmt letztlich die Größe von Kanälen, Ventilatoren und die Dimension aller Hauptkomponenten (Filterfläche, Heiz-/Kühlregisterfläche, WRG). Daher gilt: so klein wie möglich, so groß wie nötig. Eine fein abgestimmte Bedarfsanalyse (inkl. Spitzenlasten vs. Dauerlasten) erlaubt es, den optimalen Volumenstrom festzulegen. Überschlägig kann man normative Tabellen (vgl. Anhang, Tabelle A1) mit Richtwerten pro Nutzungsart verwenden, diese sollten aber immer projektspezifisch validiert werden.
Luftwechselrate und Raumströmung
Die Luftwechselrate (LW), angegeben in 1/h, ist eng verknüpft mit dem Volumenstrom und dem Raumvolumen: LW = Volumenstrom / Raumvolumen. Sie dient als anschauliches Maß dafür, wie oft pro Stunde die Raumluft theoretisch ausgetauscht wird.
In der Planung werden oft Mindest-Luftwechselraten vorgegeben:
Komfortbereiche (Büro, Wohnräume): ~1–3 1/h, wie oben beschrieben. Als Mindestwert gilt 0,5 1/h für Wohnräume (hygienischer Feuchteschutz), für Büroräume ~1 1/h. Empfehlenswert zur guten Luftqualität sind 2–3 1/h.
Versammlungs- und Bildungsräume: ~4–8 1/h (z.B. Aula, Hörsaal: 6–8 1/h werden genannt). Hohe Personenzahl und wechselnde Belegung erfordern solche Werte, um CO₂ <1000 ppm zu halten.
Labor, Werkstatt: Wie erwähnt ~5–10 1/h in vielen Fällen. Die Tabelle im Anhang (siehe Auszug) nennt für Labore 2–5 minimal, was aber nur für wenig belastete Labore gilt; real sind oft >6 1/h. Werkstätten 4–6 1/h.
Krankenhaus: 5–8 1/h auf Normalstation, Intensivstationen >6–8, OP >20 (wobei OPs oft nicht in 1/h angegeben werden, da TAV-Systeme die Luftqualität über sterile Felder definieren).
Gewerbliche Küchen: extrem hoch, 15–30 1/h Abluft in Kochbereichen, um Wärme und Dämpfe abzuziehen.
Lager: nicht klar normiert in 1/h, eher pro m² oder je nach Toröffnungen etc. Faustwert: 0,5–1 1/h als Grundlüftung.
Die Luftwechselrate alleine ist jedoch kein hinreichendes Kriterium für gute Lüftung. Wichtig ist auch die Art der Strömung im Raum:
Mischlüftung vs. Verdrängungslüftung.
Mischlüftung: Klassischer Fall mit Deckenauslässen, die Zuluft mit etwas höherer Geschwindigkeit einbringen, so dass sie sich mit Raumluft vermischt und im ganzen Raum eine einheitliche Konzentration entsteht. Hier kann man gut mit Luftwechselraten rechnen, da die Annahme des homogenen Vermischens gilt (CO₂ oder Schadstoffe verteilen sich gleichmäßig).
Verdrängungslüftung: Zuluft wird bodennah oder wandnah langsam und ohne Verwirbelung eingebracht, steigt mit Erwärmung nach oben und verdrängt die Luft nach oben, wo sie abgesaugt wird. Dadurch gibt es eine Schichtung: unten Frischluft, oben Abwärme und Schadstoffe konzentriert. Solche Systeme (z.B. in Versammlungsstätten oder Fabriken) können mit geringeren effektiven Luftwechseln gleiche Luftqualität erzielen, weil die Zuluft nicht sofort mit belasteter Luft vermischt wird, sondern gezielt Verunreinigungen nach oben abführt. In Auslegung muss man hier statt pauschaler Luftwechsel auf die Strömungsführung achten und bspw. Quelllüftung dimensionieren (oft Volumenströme pro Fläche, um eine bestimmte Ausbreitung zu erreichen).
Raumhöhe spielt ebenfalls eine Rolle: In hohen Räumen (Industriehalle) sagt eine Zahl X 1/h wenig über die Luftqualität am Aufenthaltsbereich aus, da viel Luft oben "hängen" bleibt. Hier bezieht man sich besser auf m³/h pro m² oder Lüftungseffektivität.
Zusammengefasst: Luftwechselraten liefern einen schnellen Anhaltswert und werden in Normen oft tabellarisch angegeben, aber die Auslegung muss immer den qualitativen Aspekt der Strömung berücksichtigen. Z.B. 6 fach/h in einem großen Saal per Mischlüftung könnte schlechtere CO₂-Werte an den Personen ergeben als 4 fach/h mit guter Quelllüftung. Planer nutzen daher zunehmend Strömungssimulationen (CFD), insbesondere in komplexen Räumen, um sicherzustellen, dass die geplanten Luftwechsel auch tatsächlich die gewünschte Luftgüte und Temperaturverteilung bringen.
Thermische Dimensionierung (Heizen, Kühlen, Befeuchten)
Neben der Luftmenge ist die thermische Auslegung eine Kernaufgabe. Eine RLT-Anlage liefert konditionierte Luft, d.h. sie muss erforderlichenfalls erwärmen, kühlen, entfeuchten oder befeuchten.
Heizlast über RLT: In vielen Gebäuden ist die RLT-Anlage dafür zuständig, zumindest einen Teil der Heizwärme bereitzustellen. Das Heizregister im Zuluftstrom wird so dimensioniert, dass es die Zuluft von minimaler Außenlufttemperatur (z.B. -12 °C Auslegungstemperatur) auf eine definierte Zulufttemperatur erwärmen kann, typischerweise ~18 °C (beim Einblasen in Aufenthaltszonen, damit es nicht zieht) oder höher, je nach System. In Vollklimaanlagen, die allein heizen, müsste die Zuluft sogar auf ~35 °C gebracht werden, um den Raum zu erwärmen – das ist ineffizient, daher macht man oft eine Kombination: Grundlast via Heizflächen (Radiatoren/Fußboden) und Rest über Lüftung. Wichtig ist, dass das Zusammenspiel funktioniert: die RLT-Heizung wird meist nach Volllast dimensioniert, aber in Teillast über Regelventile modulierend gefahren.
Kühllast und Entfeuchtung: Sommerliche Kühlung erfolgt oft vollständig über RLT (z.B. in Büros, wenn keine separate Kälte im Raum ist). Das Kühlregister muss die Zuluft von z.B. 32 °C Außentemperatur auf ~16–18 °C abkühlen können, damit Räume auf ~24–26 °C bleiben. Das entspricht großen Energieflüssen. Gleichzeitig sinkt dabei die Luftfeuchtigkeit (kalte Zuluft ist trocken); eine Entfeuchtung findet statt, wenn am Kühlregister Tauwasser anfällt (Luft unter Taupunkt gekühlt wird). Die Auslegung der Kühlleistung ist also auch eine Feuchtelast-Auslegung: In Schwimmbädern z.B. dimensioniert man primär auf Entfeuchtungslast. Auch in klimatisierten Büros berechnet man Kühllast nach DIN EN 16798-1 bzw. VDI 2078. Beim Kühlen wird oft Umluft beigemischt, um Energie zu sparen, weil reine Außenluftkühlung sehr teuer ist; es sei denn, Free Cooling ist möglich (kühle Nachtluft, etc.).
Wärmerückgewinnung spielt enorm hinein: Ein gutes WRG-System (z.B. Rotationswärmetauscher oder Plattenwärmetauscher) kann >70 % der Wärme aus der Abluft an die Zuluft übertragen. Dadurch reduziert sich der Heizwärmebedarf drastisch. Auch Kühlenergie kann teilweise zurückgewonnen werden (Rotationswärmetauscher mit sorptiver Beschichtung oder Umluftschaltungen). Normativ ist in vielen Ländern inzwischen ein WRG vorgeschrieben, wenn Luftströme groß sind (in Deutschland nach GEG müssen Lüftungsanlagen mit >4000 m³/h Außenluft eine Wärmerückgewinnung haben, sofern technisch machbar). In dieser Arbeit werden WRG-Systeme als eigener Parameter weiter unten behandelt.
Befeuchtung: Das Luftbefeuchten ist eine heikle, aber manchmal notwendige Angelegenheit. In rein komfortorientierten Büros wird es heute oft vermieden, da Befeuchter hygienische Risiken (Legionellen, Schimmel) bergen, hohe Wartung kosten und auch energetisch ungünstig sind. In Museen, Krankenhäusern, Laboren etc. kann Befeuchtung aber Pflicht sein, um z.B. mindestens 30–40 % r.F. zu halten (Medizin: zum Schutz der Schleimhäute, Elektronik: gegen ESD, Kunstgegenstände: Holzrisse vermeiden). Die Dimensionierung der Befeuchtungskapazität richtet sich danach, wie trocken die Außenluft im Winter ist (bei -10 °C und 90 % r.F. hat Außenluft praktisch 1–2 g/kg Wasserdampf; auf 22 °C 40 % r.F. benötigt sie ~7 g/kg – diese Differenz muss der Befeuchter liefern). Man bestimmt eine maximale Feuchtelast in kg Wasser pro Stunde und wählt entsprechend Dampfluftbefeuchter oder Zerstäuber. VDI 6022 schreibt hierbei strenge Kontrolle vor: z.B. nur auf <75 % r.F. im Kanal befeuchten, um Kondensat zu vermeiden, und regelmäßige Hygienechecks (Befeuchterwasser keimfrei halten).
Auslegungstechnisch werden Heizregister, Kühlregister, Befeuchter nach den berechneten Spitzenlastfällen dimensioniert, plus Sicherheitszuschlag. In der Praxis sind diese Komponenten meist standardisiert (z.B. in RLT-Geräten modulare Registergrößen). Daher muss oft die genaue Kennlinie mit dem Hersteller abgeglichen werden.
Abhängigkeiten:
Die erforderliche Heiz- und Kühlleistung hängt stark von Gebäudeparametern (Dämmung, solare Gewinne, interne Lasten) ab. Moderne Gebäude mit Wärmeschutz brauchen ggf. weniger Heizleistung über Lüftung, jedoch wegen hoher Dichtigkeit eine kontinuierliche Lüftung.
Nutzeranforderungen bestimmen Sollwerte: Will ein Nutzer ganzjährig 22 °C konstant, ist Kühlung Pflicht und groß auszulegen; nimmt er im Sommer auch mal 26 °C in Kauf (Kategorie II Komfort), kann Kühlleistung kleiner angesetzt werden.
Gleichzeitigkeit: In gemischt genutzten Gebäuden (z.B. Büro und Lager) kann man Lasten ausgleichen – z.B. Kühlung für einen Serverraum erzeugt Kaltwasser, dessen Abwärme kann zum Heizen anderer Bereiche genutzt werden (Stichwort Wärmenutzung aus Prozessabwärme).
Regelung: Variable Volumenstromsysteme erfordern spezielle Auslegung der Heiz/Kühlregister, damit sie auch bei Teillast (z.B. halber Volumenstrom) noch genug Leistung übertragen können. Oft werden dafür Umlenkbleche oder zweistufige Register verwendet.
Zusammenfassend ist die thermische Dimensionierung ein kritischer Teil der Auslegung: Sie stellt sicher, dass die RLT-Anlage nicht nur Luft austauscht, sondern auch die thermischen Komfortbedingungen einhält. In der Beschaffung muss darauf geachtet werden, dass die angegebenen Leistungen (kW Heiz-/Kühlleistung) auch bei den spezifischen Bedingungen erreicht werden (Luftmenge, Eintrittsbedingungen, Mediumstemperaturen), und passende Regelventile, Fühler und Steuerungsstrategien vorhanden sind, um die Temperatur und Feuchte bedarfsgerecht zu regeln.
Energieeffizienz und Kennzahlen
Angesichts steigender Energiekosten und Klimaschutzvorgaben ist die Energieeffizienz von RLT-Anlagen zu einem der wichtigsten Dimensionierungskriterien geworden. Bereits in der Planungsphase müssen Konzepte zur Reduktion des Energieverbrauchs berücksichtigt werden.
Wesentliche Kennzahlen und Aspekte:
SFP-Wert (Specific Fan Power): Dieser Wert gibt an, wie viel elektrische Leistung die Ventilatoren pro Luftvolumenstrom benötigen, typischerweise in W/(m³/h) oder ähnlichen Einheiten. Je kleiner, desto effizienter. Gesetzliche Richtlinien (Ökodesign-Verordnungen der EU) setzen Maximalwerte für Ventilatoren und RLT-Geräte. Ein moderner zentraler RLT-Anlage sollte SFP < ca. 0,5 Wh/m³ erreichen (umgerechnet ~1,8 kJ/m³). Das entspricht z.B. bei 10 000 m³/h einem Ventilatorstrom von 5 kW. Effizienz erreicht man durch strömungsgünstige Konstruktion, große Querschnitte (geringe Druckverluste) und hochwirksame Motoren/Ventilatoren. Dimensionierungsfolge: Es kann sinnvoll sein, Kanäle größer zu dimensionieren als minimal nötig, um Druckverluste zu senken und Energie zu sparen. Allerdings steigen damit Kosten und Platzbedarf – ein Optimierungsprozess. Norm DIN EN 16798-3 fordert explizit, dass Luft mit minimalen Energieverlusten gefördert werden soll.
Wärmerückgewinnungsgrad: Kennzeichnet, wie viel Wärme aus der Abluft zurückgewonnen wird. Hochwertige Plattenwärmeübertrager oder Rotationswärmetauscher erreichen 70–90 % Wärmebereitstellungsgrad; spezielle Systeme (Gegenstrom-WRG mit Feuchterückgewinnung) sogar bis 98 % unter Idealbedingungen. Planerisch legt man oft einen Ziel-Wirkungsgrad fest, z.B. „≥ 75 % nach EN308“ und wählt das WRG-Gerät entsprechend. Ein höherer WRG-Grad erlaubt kleinere Heizregister und spart Heizenergie. Bei der Kühllast hilft WRG in unseren Breiten begrenzt (da im Sommer die Abluft kühler als Außenluft ist, kann ein Teil vorgekühlt werden, aber nicht so erheblich wie im Winter der Wärmefall). Enthalpie-WRG (feuchteübertragend) können auch im Winter Luft befeuchten bzw. trocknen – das spart Befeuchterleistung.
Leckage und Dichtheit: Effiziente Anlagen sind gut gedämmt und dicht. Luftleckagen in Kanälen oder Gerät bedeuten Verlust (ungewollter Luftpfad). Normen fordern Dichtheitsklassen (z.B. ATC 2 für Kanäle), was bei Dimensionierung der Druckhaltung und bei Abnahmemessungen geprüft wird. Ebenso Wärmedämmung: Kanäle nach außen (Kaltluftführend) müssen gut gedämmt sein, um keine Energie zu vergeuden und Kondensat zu vermeiden.
Bedarfsgerechte Steuerung: Ein enormer Effizienzhebel ist die Anpassung an tatsächliche Bedürfnisse. Statt konstant 100 % Volumenstrom zu fahren, sollte die Anlage z.B. Teillast fahren, wenn weniger Personen anwesend sind. CO₂-, Temperatur- oder Feuchtesensoren können die Regelung beeinflussen (Stichwort DCV: Demand Controlled Ventilation). In großen Bereichen kann eine VVS (variable Volume) mit einzelnen Regelklappen pro Zone Energie sparen: es wird nur dort viel Luft gefördert, wo auch Belastung ist. Die Einführung von Gebäudautomation (GA) und smarten Steuerungen hilft, diese Möglichkeiten zu nutzen. Moderne Systeme integrieren z.B. Bewegungssensoren, Zeitpläne, und IoT-Sensorik, um in Echtzeit Volumenströme zu modulieren. Ein Nebeneffekt: höhere Komfort (bessere Kontrolle der Luftqualität) bei niedrigeren Kosten.
Freie Kühlung/Nachtlüftung: Effizienz kann auch durch kreative Konzepte gesteigert werden. Ein Beispiel: Sommernachtskühlung durch die RLT-Anlage – nachts wird kühle Außenluft ins Gebäude geblasen (wenn Außentemperatur < Innentemperatur), um die Gebäudemasse zu kühlen. Damit lässt sich am Tag die Klimakälte reduzieren. In der Dimensionierung muss dafür evtl. ein Bypass am WRG (um nicht zu erwärmen) und geeignete Steuerung eingeplant werden.
Energiemonitoring: Für den Betrieb wichtig, aber schon in Beschaffung vorzusehen, sind Zähler und Monitoring. Gute Planung schreibt z.B. vor: installiere Stromzähler an den RLT-Stromkreisen, Wärmemengenzähler an Heiz-/Kühlregister. So kann im Betrieb die Effizienz überwacht und optimiert werden.
Normativ liefert u.a. DIN EN 16798-3 Mindestanforderungen an Effizienz. Zusätzlich sind EU-Ökodesign-Vorgaben für RLT-Geräte (Verordnung EU 1253/2014) bindend: sie definieren z.B. minimalen Wärmerückgewinnungsgrad (≥73 % seit 2018) und maximalen SFP_int (Specific Fan Power internal) abhängig von Gerätegröße. Bei Nichteinhaltung darf ein Gerät nicht in Verkehr gebracht werden. Das beeinflusst direkt die Beschaffungskriterien, da man nur noch zertifizierte Geräte (z.B. Eurovent-Zertifikat) auswählen sollte.
Ein Beispiel konkreter Effizienzbetrachtung: Laut Untersuchungen entfallen etwa 80 % der Lebenszykluskosten eines Luftfilters auf die Energiekosten, nicht Anschaffung. Ein sauberer Filter verursacht ~25 % des Lüftungsanlagen-Energiebedarfs, ein verschmutzter Filter ~50 %. Daher wird klar, dass Filterwartung und clevere Filterauswahl (z.B. etwas größere Filterfläche, geringerer Druckverlust) massive Energieeinsparungen bringen können. Solche Zahlen motivieren Betreiber, auf Effizienz in jedem Detail zu achten.
In Summe muss Energieeffizienz bereits beim Dimensionieren ein integraler Bestandteil sein: von der Auswahl der Komponenten (Ventilator, WRG, Motor mit Frequenzumrichter) über die Netzdimensionierung bis zur Regelstrategie. Die beste Anlage ist eine, die bei minimalem Energieeinsatz die geforderte Leistung erbringt – weder Unter- noch Überversorgung, sondern „gerade richtig“.
Betriebszeiten und Nutzungsprofile
Die Betriebszeiten einer RLT-Anlage definieren, wann und wie lange sie in welchem Modus läuft. Unterschiedliche Nutzungsprofile haben hier erheblichen Einfluss auf die Auslegung:
Dauerbetrieb vs. zeitweiser Betrieb: Einige Anlagen laufen 24/7 (z.B. im Krankenhaus, Reinraumproduktion oder in Gebäuden mit Schichtbetrieb). Andere laufen nur tagsüber oder bei Bedarf (Büro werktags, Schule tagsüber, Theater abends). Für Planer bedeutet das: Komponenten müssen ggf. Dauerlast-tauglich sein (24h-Betrieb erfordert z.B. sehr zuverlässige Ventilatoren, eventuell 1-2 Ersatzrotoren vorhalten für schnellen Tausch, etc.). Bei Teilzeitbetrieb ist es wichtig, Aufheiz- und Abkühlphasen einzuplanen: Eine Anlage, die morgens startet, muss genug Leistung haben, um ein über Nacht ausgekühltes Gebäude schnell auf Komfort zu bringen – manchmal werden dafür sog. Aufheizprogramme mit erhöhtem Volumenstrom und Temperatur gefahren.
Nacht-, Wochenendabschaltung: Wo immer möglich, soll die Anlage außerhalb der Nutzungszeiten zurückgefahren oder ausgeschaltet werden, um Energie zu sparen. Dabei entstehen aber Anforderungen wie Frostschutz (im Winter darf ein abgestelltes System nicht einfrieren – Lösung: Frostschutzthermostat, minimaler Umluftbetrieb, oder nachlaufende Pumpen für Heizregister). Auch Feuchte: in Museen oder Archiven kann man nicht einfach abschalten, da Feuchte/Wärme entgleiten könnten – dort laufen Anlagen durch oder zumindest im reduzierten Modus.
Teillastbetrieb: Nutzt ein Gebäude verschiedene Zonen mit unterschiedlichen Nutzungsprofilen (z.B. in einem Unigebäude: Hörsäle nur gelegentlich voll, Büros regulär), braucht es flexible Anlagenschemen. Das kann bedeuten: mehrere RLT-Anlagen für unterschiedliche Bereiche anstatt einer großen (um separat schalten zu können). Oder ein System mit Zonenregelung. Dimensionierungsseitig muss man abschätzen, wie oft Volllast anliegt. Beispielsweise bei 10 Hörsälen, die nie alle gleichzeitig vollbesetzt sind, kann man eventuell simultane Nutzung geringer annehmen (Diversitätsfaktor) und die Zentrallüftung etwas knapper auslegen – sofern sichergestellt ist, dass nie Full House ohne Anpassung passiert.
Wartungszeiten: Betriebsprofil schließt auch geplante Stillstände ein. Große Anlagen brauchen gelegentlich Wartung (Filterwechsel, Inspektion). Im Konzept sollte verankert sein, ob das im laufenden Betrieb möglich ist (besser redundant oder abschnittsweise) oder ob man kurze Abschaltungen zulässt (z.B. an Wochenenden). In kritischen Anwendungen sind wechselweise versorgende Anlagenteile eine Lösung: z.B. zwei parallel RLT-Geräte, von denen immer eins gewartet werden kann, während das andere läuft (häufig in Krankenhäusern so realisiert).
Betriebsführungsstrategie: Hierüber entscheidet oft der Betreiber im FM, aber Planer sollten Grundlagen schaffen. Etwa: Einbindung in GLT (Gebäudeleittechnik), sodass Fahrpläne zentral anpassbar sind, Störmeldungen kommen etc. Die Fähigkeit zum bedarfsgeführten Einschalten (z.B. CO₂-Sensor startet Anlage automatisch wenn Personen im Raum sind) kann man dimensionierungsseitig voraussehen: z.B. höhere Anfahrleistung, eventuelle Bypassklappen für schnellen Stoßlüften etc.
Beispiel:
Ein Logistiklager ist nur Mo–Fr tagsüber in Betrieb. Man plant die Lüftungsanlage daher mit dem Gedanken, sie nachts komplett aus zu lassen. Jedoch lagern dort feuchteempfindliche Waren – im Sommer könnten diese bei stillstehender Lüftung Schaden nehmen. Lösung in der Planung: Umluft-Entfeuchtungsschaltung – nachts bei Überschreitung einer Sollfeuchte schaltet die Anlage im Umluftbetrieb mit Kälte an, um Feuchte rauszukondensieren. Oder alternative: minimale Außenluft auch nachts wenn nötig (aber dann mit Entfeuchtung). Dieses Beispiel zeigt, Betriebsprofile sind mehr als An/Aus – manchmal müssen auch Sonderfälle berücksichtigt werden.
Insgesamt beeinflusst das Nutzungsprofil also Größe und Anzahl der Anlagen (lieber mehrere kleine, die separat laufen, als eine große, die immer laufen muss), Auslegung der Heiz-/Kühlsystemträgheit (Aufheizleistung, Speichermassen) und Regelkonzepte. Für die Beschaffung ist es sinnvoll, gleich festzulegen: Welche Betriebsarten werden vom Regler unterstützt (Tag/Nacht/Umluft, Notbetrieb etc.), und gibt es Automatik für Ferienzeiten, Auslastung etc.? Je besser abgestimmt auf die reale Nutzung, desto effizienter und wirtschaftlicher der Betrieb.
Wärmerückgewinnungssysteme
Wärmerückgewinnung (WRG) ist heute bei größeren RLT-Anlagen fast standardmäßig vorgesehen, da sie erheblich zur Energieeinsparung beiträgt. Es gibt verschiedene Technologien: Rekuperativ (Plattenwärmetauscher, Kreislaufverbundsystem) oder Regenerativ (Rotationswärmetauscher). Wichtig für die Dimensionierung:
Art des WRG-Systems:
Plattenwärmetauscher (feststehend, kein Durchmischen von Luftströmen): hoher Wirkungsgrad bis ~80%, keine beweglichen Teile, aber starre Luftführungsgeometrie. Erzeugt einen zusätzlichen Druckverlust (muss Ventilatorleistung erhöhen). Außerdem entstehendes Kondensat muss abgeleitet werden (Kondensatwanne). Bei Frost kann es vereisen, daher Dimensionierung ggf. mit Bypass oder Vorheizregister, um Frostgrenze zu managen.
Rotationswärmetauscher (Drehwärmerad): sehr hohe Wirkungsgrade (80–90%), inkl. Feuchterückgewinnung wenn Sorptionsrad. Braucht Antriebsmotor, geringeren Druckverlust als Platten-WT, aber birgt Übertrag von Feuchte und Gerüchen (Leckage typ. 3–5%, in sensiblen Bereichen problematisch – kein Einsatz wo Abluft kontaminiert ist, z.B. Krankenhaus-OP Abluft nie über Rotary ins Zuluft). Dimensionierung: man wählt Durchmesser und Drehzahl nach gewünschtem Effekt. Rotationswärmeräder sind i.d.R. die effizienteste Wahl für Bürobauten etc., solange Hygiene kein Gegenargument ist.
Kreislaufverbundsystem (KVS): Hier zirkuliert ein Wärmeträgermedium in zwei geteilten Register (eines im Abluft, eines im Zuluftstrom). Flexibel einsetzbar, auch räumlich getrennt (z.B. Abluft oben durchs Dach, Zuluftgerät im Keller). Wirkungsgrad mittel (50–70%). Vorteil: kein Luftvermischen, Frostunempfindlicher (kann Glykolgemisch sein), modulierte Leistung über Pumpensteuerung. Nachteil: braucht Pumpe und Rohrleitungen, mögliche Wartung mehr.
Heatpipe-WRG: Wärmeübertragung mittels Phasenwechsel in geschlossenen Rohren. Wartungsarm, robust, aber meist fix und weniger anpassbar (bzw. Effizienz ~50–60%). Selten in Mitteleuropa genutzt, eher in trockenen Klimata.
Dimensionierungskriterien: Man muss den gewünschten Temperaturaustauschgrad definieren. Beispielsweise soll im Winter die -10 °C Außenluft durch WRG auf mindestens +5 °C vorgewärmt werden, bevor Heizen. Das entspricht ~75% Effizienz falls Abluft 22 °C hat. Dementsprechend wählt man z.B. einen Platten-WT der Größe X. Viele Hersteller geben Kennfelder, Planer können ausrechnen oder Software-Tools nutzen (teilweise erforderlich, da Effizienz auch vom Volumenstromverhältnis Abluft/Zuluft abhängt und von Feuchte). Für Befeuchtung spielt Feuchterückgewinnung eine Rolle: ein Sorptionsrad kann sowohl fühlbare als auch latente Wärme übertragen – es kann im Winter die oft sehr trockene Außenluft etwas befeuchten mit der Abluftfeuchte, was gewünscht ist, um Befeuchterleistung zu sparen.
Druckverlust und Größe: WRG-Einheiten nehmen Platz ein. Platten-WT benötigen Bypass-Klappen (um bei zu viel Wärme im Sommer oder bei Frost entkoppeln zu können). In der Anlagenaufstellung muss man diesen Platz vorsehen. Rotationswärmetauscher sind kompakt, aber brauchen Wartungszugang (Motor, Dichtungen kontrollieren). Der zusätzliche Druckverlust (typisch 100–300 Pa) muss in Ventilatorenauslegung eingerechnet werden, erhöht Motorleistung.
Umluftbetrieb und Leckage: In manchen Situationen (z.B. bei sehr niedrigen Außentemp.) wird eine Umluftschaltung oder Bypass gewünscht: d.h. man möchte temporär die Außenluft reduzieren. Mit WRG ist das aber konterkarierend. Daher haben viele Anlagen Bypassklappen: im Sommer kann man WRG überbrücken, um keine Wärme reinzuholen (Free Cooling Mode). Oder im Abtaubetrieb: Wenn Platten-WT vereisen (Abluftfeuchte kondensiert und friert), braucht es ein Abtaumanöver – oft wird dann stoßweise Zuluft am WT vorbeigeführt und Abluft erhitzt ihn. Das muss steuerungstechnisch eingebaut sein.
Hygiene: WRG kann hygienische Implikationen haben. VDI 6022 fordert z.B., dass bei Nutzung in sensiblen Bereichen Rotationswärmetauscher entweder ab besonderen Dichtungen oder gar nicht genutzt werden sollen, wegen Rücktrag von Partikeln. Platten-WT sollten keine Schimmelquelle werden – sprich, gute Kondensatableitung, keine organischen Ablagerungen. KVS haben keine Luftvermischung, sind also hygienisch unkritischer, aber ihre Befeuchterwanne (wenn vorhanden) muss sauber bleiben.
Energetisch bringt eine gute WRG enorme Vorteile: z.B. in einer 10 000 m³/h Anlage mit 80% WRG lassen sich jährlich zigtausende kWh Heizenergie einsparen (abhängig vom Klima). Das rechnet sich meist in wenigen Jahren, weshalb es Stand der Technik ist, immer WRG vorzusehen, außer in Ausnahmefällen (kleine Abluftvolumen, Gefahrstoffabluft die nicht ins Zuluftsystem darf, etc.).
In der Beschaffung sollte man auf zertifizierte Leistungsdaten achten, etwa Eurovent-Zertifizierung der WRG-Angaben, da Herstellerangaben sonst schwer vergleichbar sind. Außerdem muss die Regelung (Bypass, Drehzahlsteuerung Rotationsrad etc.) entsprechend mit ausgeschrieben werden.
Filterung und Filterklassen
Luftfilter sind unverzichtbarer Bestandteil jeder RLT-Anlage. Sie schützen sowohl die menschlichen Nutzer als auch die Anlage selbst vor Schmutz und Schadstoffen. Die Dimensionierung der Filter betrifft folgende Punkte:
Filterkonzept (Stufenkonzept): Üblich ist eine zweistufige Filterung der Außenluft:
Vorfilter (Grob- oder Mittelfilter): entfernt grobe Partikel, Flusen, Insekten, einen Teil von Staub/Pollen. Früher bezeichnet als z.B. G4 oder M5, nach neuer Norm ISO 16890 werden Filter nach Abscheidegrad für Partikelgrößen ePM10, ePM2,5, ePM1 eingestuft. Ein typischer Vorfilter wäre ISO ePM10 50% (entspricht ungefähr alter M5).
Hauptfilter (Feinfilter): entfernt feinere Partikel, trägt maßgeblich zur Innenraumluftqualität bei. Z.B. ISO ePM1 80% (entspricht ungefähr F9). Damit wird Feinstaub und ein großer Teil der Partikel herausgefiltert.
Bei besonders hohen Anforderungen (Krankenhaus-OP, Reinraum, Pharma) folgt dann noch eine dritte Stufe:
3. Schwebstofffilter (HEPA/ULPA): Filter der Klassen H13, H14 (oder höher) können 99.95–99.995% der Partikel >0,3 µm abscheiden, also praktisch keimfreie, partikelfreie Luft liefern. Diese werden aber i.d.R. nicht direkt im zentralen RLT-Gerät verbaut (wegen Kosten und der gesamten Luftmenge), sondern dezentral vor Ort – z.B. in OP-Decken, Reinraumauslässen.
Filterauswahl nach Luftqualität: Die DIN EN 16798-3 koppelt die Filterauswahl an Außenluft- und Raumluftklassen. Beispiel: Bei Außenluftqualität ODA 2 (mäßig verschmutzt, z.B. Stadtluft mit Feinstaub/NOx leicht erhöht) und gewünschter hoher Zuluftqualität SUP 2 (faktor 0,5 der Grenzwerte), wird man mindestens ePM1 80% als zweite Stufe brauchen, evtl. plus ePM10 Vorfilter. ODA 3 (stark verschmutzte Außenluft, z.B. Nähe Industrie) erfordert sehr gute Filter, ggf. sogar Aktivkohlefilter gegen Schadgase, um SUP-Klassen zu erreichen. Aktivkohle oder andere Molekularfilter sind üblich, wenn Gerüche oder Gase (SO2, Ozon etc.) ein Problem sind – z.B. in Museen (gegen Schadgase für Exponate), Labore (Chemikaliengerüche), Küchen (Geruchsfilter vor Abluftauslass). Solche werden als separate Stufe dimensioniert, oft nach dem Hauptfilter.
Filterwiderstand und Fläche: Dimensionierung eines Filters heißt vor allem, genug Filterfläche vorzusehen, damit die Gesichtsgeschwindigkeit gering bleibt. Typisch soll die Luft durch den Filter <2 m/s strömen (besser 1–1,5 m/s), um hohe Abscheidung und lange Standzeit zu erreichen. Bei 10 000 m³/h Volumen und z.B. 2 m/s Geschwindigkeit bräuchte man 1,4 m² Filterfläche – das wird mit Falt- oder Taschenfiltern erreicht, die viel Medienfläche in kompakter Form bieten. Der anfängliche Druckverlust eines neuen Filters liegt oft bei 50–150 Pa; über die Betriebszeit steigt er (auf vielleicht 200–300 Pa, dann Wechsel). Planer geben meist einen Enddruckverlust vor (z.B. 200 Pa für Vorfilter, 300 Pa für Feinfilter), nach dem gewechselt werden soll, und dimensionieren Ventilatoren auf diesen Wert, um auch bei vollem Filter noch genug Luft zu liefern.
Hygiene: Filter sind auch hygienerelevant – ein feuchter, verschmutzter Filter kann Nährboden für Keime sein. Deshalb VDI 6022 verlangt: vor Befeuchtern immer Filter, nach Befeuchter ggf. Tropfenabscheider, keine dauerhaft durchnässten Filter, regelmäßige Inspektion. Bypass-Leckagen am Filterrahmen müssen vermieden werden (gute Abdichtung oder Filtersysteme mit Dichtlippen).
Wartungszugänglichkeit: Schon bei der Planung wird berücksichtigt, wie Filter gewechselt werden: Es muss Platz sein, um Filterzellen rauszuziehen (Platzbedarf in Längsrichtung), und eine Zugangstür. Außerdem sollten Differenzdruckmesser eingebaut werden (manometer oder Sensor), um Verschmutzungsgrad zu überwachen.
Filterklassen beispielhaft:
Bürogebäude in Stadt: Vorfilter ISO ePM10 50%, Hauptfilter ePM1 70–80%.
Krankenhaus Normalbereich: Vorfilter ePM10 70%, Hauptfilter ePM1 80–90%. OP: zusätzlich H14 in OP-Decke.
Labor mit giftigen Stäuben: ähnlich, plus Abluft-HEPA.
Industrie mit Holzstaub: evtl. spezieller Funkenvorabscheider + normaler Filter.
Rechenzentrum: oft nur ePM2.5 50% ausreichend (Personen selten, aber Geräte vor Staub schützen).
Ein richtig ausgelegtes Filtersystem hat große Auswirkungen auf Lebenszykluskosten (siehe obiges Filterbeispiel, Energieanteil). Daher überlegen manche Betreiber, Feinstaub direkt an der Quelle zu reduzieren (z.B. Begrünung, Staubschutz an Zuluftöffnungen), um Filter zu entlasten.
Man kann auch auf Filter mit längerer Standzeit gehen (Bagfilter mit mehr Fläche) – initial teurer, aber seltener Wechsel, geringerer Druckverlust. Solche Entscheidungen fließen in die Beschaffung ein: z.B. Angabe "Filter F7 als Taschenfilter, min. 10 Taschen, Filterfläche min. XY m²".
Insgesamt ist das Filterkonzept eng verzahnt mit Normvorgaben (DIN EN 16798, VDI 6022) und Praxis (Standzeit, Wartungskosten). Planung und Beschaffung müssen sicherstellen, dass die gewünschte Luftqualität dauerhaft eingehalten werden kann und das Filtersystem wirtschaftlich arbeitet.
Akustische Anforderungen (Schall)
Ein oft unterschätzter, aber für den Nutzer erfahrbarer Parameter ist der Schallpegel, den eine RLT-Anlage verursacht. Dimensionierung muss die Schalldämpfung und schalltechnische Maßnahmen berücksichtigen, um Komfortkriterien einzuhalten (vgl. VDI 2081):
Schallquellen: Ventilatoren sind die Hauptquelle von Anlagen-Innengeräuschen. Strömungsgeräusche entstehen an Engstellen, Umlenkungen, Drosselorganen, Auslässen. Außerdem können RLT-Geräte Körperschall (Vibrationen) ins Bauwerk übertragen.
Zulässige Pegel: Für unterschiedliche Räume gibt es Richtwerte (z.B. Wohn-/Büroräume ~35–40 dB(A) max., Konferenz 30–35, Schlafzimmer/Krankenzimmer 25–30, etc.). Industrielle Hallen dürfen lauter sein, aber oft geht es auch um Kommunikation (max. ~50–60 dB(A) am Arbeitsplatz).
Dimensionierung von Schalldämpfern: Um erforderliche Pegel zu erreichen, werden Schalldämpfer im Kanalnetz vorgesehen. Das sind i.d.R. Kulissenschalldämpfer mit schallabsorbierendem Material (mineralische Wolle, melaminharz-Schaum o.ä.), die in den Zuluft- und Abluftleitungen kurz nach dem RLT-Gerät eingebaut werden. Ihre Dimensionierung umfasst die Dämpfung pro Frequenzband und den Druckverlust. Man wählt Länge, Querschnitt und Kulissendicke/Abstand so, dass kritische Frequenzen ausreichend gedämpft werden (tiefe Frequenzen erfordern lange Dämpfer). VDI 2081 liefert Rechenmethoden und empirische Werte hierfür. Oft
